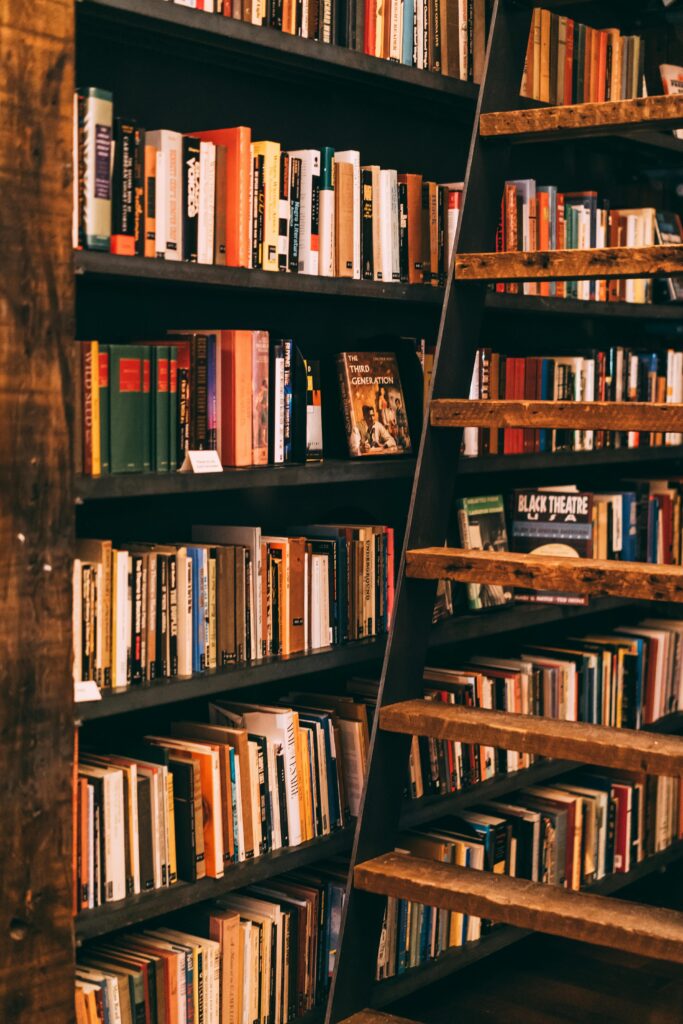Anmerkung der Verfasserinnen: Der folgende Artikel porträtiert zwei Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit. Das Ehepaar möchte weitestgehend anonym bleiben, weshalb im Folgenden lediglich ihre Vornamen aufgeführt sein werden,
Karl war ab den 1950er Jahren als Übersetzer in der noch jungen Bundesrepublik tätig und arbeitete in dieser Funktion unter anderem mit Franz Josef Strauss zusammen. Heute blickt er nicht nur auf seine Arbeit für hochrangige Minister zurück, sondern spricht, zusammen mit seiner Frau Heiderose, auch als Zeitzeuge über seine Kindheit und Jugend während der NS-Zeit.
Ein schwüler Sommertag; über Essen hängt eine graue Hitze. Auf der Fahrt hinaus aus der Stadt stauen sich die Autos, bis die Straßen schmaler werden und sich in grüne Landwege auflösen. Es dauert rund eine Stunde bis wir den Ort erreichen, in dem Karl und Heiderose wohnen. Das über 90 Jahre alte Ehepaar begrüßt uns herzlich und bittet uns wie selbstverständlich in ihr Wohnzimmer. Wir setzen uns an den runden, gedeckten Kaffeetisch und beginnen über das zu sprechen, was uns an diesem Tag zu ihnen führt.
Karl und Heiderose berichten regelmäßig als Zeitzeugen an Schulen über ihre Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg. Bei einem vergangenen Schulvortrag am Maria-Wächtler-Gymnasium in Essen wurden wir so auf sie aufmerksam. „Gerade heute ist das Interesse dafür besonders groß, auch von der jungen Generation“, sagen sie beide und ein nachdenklicher Blick legt sich über ihr Gesicht. „Wir können endlich das loswerden, was lange fällig war“, beschreiben sie ihre Gefühle im Hinblick auf ihre Aufgabe als Zeitzeugen. Bei unserem Besuch sprechen sie aber nicht nur über ihr Aufwachsen im Nationalsozialismus, sondern vor allem über ihr bewegtes Leben nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Übersetzer für Englisch, Französisch und Portugiesisch arbeitete Karl nämlich seit der Gründung der Bundeswehr ebenda im Sprachendienst, saß im Weißen Haus unmittelbar neben dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und war bei der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags 1963 anwesend. Doch trotz der Tatsache, dass er diese historischen Ereignisse hautnah miterlebte, wirkt er bescheiden: „Es gehörte eben zum Geschäft“, sagt er lachend. „Ich habe mich auf den Ablauf der Übersetzung konzentriert, da war keine Zeit, darüber nachzudenken, wer denn nun neben einem sitzt“, fasst er seine Erinnerung zusammen. Trotz dieser bewegten Lebensstationen erzählt er uns aber zuerst von einem anderen Projekt, das ihm besonders wichtig ist.
Einsatz für die deutsch-französische Freundschaft
Wir verlassen das durch Jalousien abgedunkelte Wohnzimmer und begleiten Karl in sein Büro, einen hellen Raum mit bodentiefen Regalen, in denen sich die Bücher bis zur Decke stapeln. Auf seinem Computer zeigt er uns Bilder eines Ortes, der ihn bis heute prägt: die restaurierte Kapelle von Falaise, die im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten errichtet und hundert Jahre später von Freiwilligen restauriert wurde. Der Ort ist gleichzeitig nicht weit entfernt von Vouziers, einer Stadt, in der der Großvater von Karls Frau, Heiderose, bereits nach 1914 gewohnt hatte. Für Karl ist die Kapelle bei Falaise zusammen mit anderen Gedenkorten, die er regelmäßig besuchte, ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft, das ihn bis heute begleitet. Seine Anwesenheit bei den jährlich abgehaltenen Gedenkveranstaltungen ist ihm ein Herzensprojekt – eine Routine, auf die er, wie er schmunzelnd sagt, nur verzichten muss, „wenn mich keiner fährt“. Er spricht mit einer ergriffenen Stimme, als er uns die Bilder zeigt, die Ausdruck seiner Verbundenheit mit dem Projekt und dem Nachbarland sind. Auf die Frage, ob Frankreich heute noch in seinem Leben eine große Rolle spielt, antwortet er ohne zu zögern „ja auf jeden Fall!“. Denn abgesehen von seiner Unterstützung für die Restauration der Kapelle ist er seit 2023 Ehrenbürger der Gemeinde Beine-Nauroy und zusätzlich Gründungsmitglied des 1948 gegründeten Cercle français in Kassel gewesen. Dass gerade er sich heute so für die deutsch-französische Freundschaft einsetzt, wirkt umso bemerkenswerter, wenn man seine Kindheit kennt.
Kindheit und Jugend in der NS-Zeit
Geboren kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, waren Heiderose und Karl jung, als der Zweite Weltkrieg 1939 ausbrach. Wenn Heiderose heute über ihre Kindheit spricht, erzählt sie zuerst von ihrem Vater – und davon, wie sehr sie ihn vermisst hat, als er als Soldat eingezogen wurde. Seine Briefe, die sie bis heute aufbewahrt, sind Zeugnisse dieser Sehnsucht. Zwischen den alten, kaum lesbaren Zeilen klingt die kindliche Traurigkeit noch immer hindurch. Später wurde sie mit ihrer Schwester von Essen nach Pommern geschickt, um dem Krieg zu entkommen. Doch die Sicherheit währte nur kurz: Im Sommer 1944 musste die Mutter sie wegen der vorrückenden Roten Armee zurückholen. Heiderose erinnert sich an einen Fliegeralarm, an den engen Bunker, an die Angst. Und an einen kleinen Jungen aus Essen, der sich im Bunker an sie klammerte und sagte: „Wenn wir sterben, dann sterben wir wenigstens zusammen. Wir sind doch beide aus Essen.“.
Während Heiderose in den letzten Kriegsjahren zwischen Flucht und Angst hin- und hergerissen war, erlebte Karl den Krieg in Kassel – inmitten eines Dreiecks aus militärischen Zielen, das regelmäßig von Bombenangriffen erschüttert wurde. „Wir haben zuhause gedacht, dass wir das nicht überleben würden, wir sind da mittendrin.“, erinnert er sich. Obwohl sie die ersten Fliegeralarme und Bombenangriffe erst einige Jahre nach Kriegsausbruch erlebten, haben diese Erfahrungen seine Familie tief traumatisiert. „Meine Mutter war seit dem ersten Angriff im Sommer 1942 nicht mehr derselbe Mensch“, sagt er und hält nachdenklich inne. Bevor er 1944 als Luftwaffenhelfer der Hitlerjugend zusammen mit seinen Klassen- und Jahrgangskameraden eingezogen wurde, besuchte er das humanistische Friedrichsgymnasium in Kassel, an dem er durch den Latein-, Griechisch- und Englischunterricht seine Begeisterung für Sprachen entdeckte. Zeitgleich begann er, sich mit Hilfe der Familienbibliothek eines Mitschülers mit amerikanischer und englischer Literatur auseinanderzusetzen. Er entkam nur durch einen glücklichen Zufall der Einberufung in die Waffen SS. Wie viele seine Altersgenossen war er schon 1944 davon überzeugt, dass der Krieg verloren war.
Völlige Perspektivlosigkeit nach dem Ende des Krieges
Heiderose erinnert sich gut an die Zeit nach dem Kriegsende. Die Stimmung war gedrückt, sagt sie, und doch versuchten sie und ihre Freundinnen, das Erlebte mit Lachen und kleinen Streichen zu übertönen. Der Unterricht fand in einem beschädigten Schulgebäude statt – bei Regen saßen die Mädchen mit aufgespannten Regenschirmen auf ihren Plätzen, während die Witwen gefallener Soldaten vor der Klasse standen und die Mädchen unterrichteten. Trotz allem blickt Heiderose mit Wärme auf diese Zeit zurück. Später, als junge Frau, ging sie nach England, um dort als Deutschlehrerin zu arbeiten – ihre erste Begegnung mit einem Land, das einst als Feind galt.
„Aber wenn der Krieg endet, ist es noch nicht vorbei“, so Heiderose. Die schweren Nachkriegsjahre seien auch an ihnen nicht spurlos vorbei gegangen, trotz ihres jungen Alters. Sie hätten trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. „Wir haben so viel gelacht“, erinnert sie sich, „und waren aber doch so froh, dass es vorbei war“. Für den damals 17-jährigen Karl markiert das Kriegsende im Mai 1945 auch einen persönlichen Wendepunkt. „Ich habe mich natürlich gefragt, was ich jetzt aus meinem Leben machen will.“ Ob er seine Wunschlaufbahn als Diplomat zu diesem Zeitpunkt einschlagen kann, wusste er nicht. Ihm war klar, „wenn Deutschland diesen Krieg gewinnt, möchte ich diesem Staat nicht dienen. Sollte Deutschland aber verlieren, wird es erstmal lange keine deutschen Diplomaten geben.“
Ein geschichtsträchtiges Berufsleben als Übersetzer beginnt
Nicht die Diplomatie, sondern die Leidenschaft für Sprachen bestimmte aber zunächst seinen Weg. Nach seiner Schulzeit erweiterte er sein Sprachrepertoire um Französisch und Portugiesisch. Nach anschließenden Stationen in Würzburg, Gießen und Mainz wurde er 1955 als Dolmetscher in Bonn eingestellt und übersetzte für führende Politiker, unter anderem Franz Josef Strauss und die Verteidigungsminister Georg Leber und Gerhard Schröder. Karl spricht beinahe nüchtern von den Größen der Bundespolitik der 1950er und 1960er Jahre, mit denen er mitunter mehrere Tage zusammen in Hotels und auf Dienstreisen verbrachte. Zu Franz Josef Strauss baute er eine besondere Beziehung auf, wobei dieser ihm anfangs noch scherzweise mit seinem bayerischen Dialekt gesagt hatte, dass Karls Übersetzungsarbeit „alles nichts bringt, solang er kein Bayrisch kann“.
Wenn Karl über seine Jahrzehnte im Dienst der Diplomatie spricht, klingt vieles bescheiden, beinahe beiläufig. Nur ein Erlebnis lässt seine Stimme fester werden: „Eindeutig das im Weißen Haus“, ruft er mit einer ihm eigenen Selbstverständlichkeit. 1962, als John F. Kennedy Präsident der USA ist und Bundeskanzler Adenauer bei einem Staatsbesuch im Weißen Haus empfing, sprang Karl spontan für eine krankheitsbedingt ausgefallene amerikanische Kollegin ein. „Ich wurde am Abend vor Adenauers Staatsbesuch bei Kennedy angewiesen, ihn am nächsten Tag zu begleiten.“, beschreibt er die Situation rückblickend. „Und da meine Papiere gültig waren, habe ich zugesagt“, sodass er nur wenige Stunden später unmittelbar neben dem US-Präsidenten saß. Eine gewisse Nervosität habe er dabei nicht verspürt, schließlich „geht es da nur um den Ablauf der Übersetzung“, so Karl. „Ich hatte natürlich einen gewissen Respekt vor der Aufgabe, vielleicht auch ein bisschen Demut“, sagt er schließlich nach einer längeren Pause.
„So hat das damals auch angefangen“
Bis 1993 arbeitete Karl als Übersetzer im Sprachendienst des Verteidigungsministeriums. Auch nach seinem Ruhestand blieb der Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen bestehen. Wenn man auf sein Leben blickt – geprägt von Krieg, Diktatur und einem jahrzehntelangen Engagement für die Verständigung zwischen den Nationen – drängt sich eine Frage auf: Wie sehen er und seine Frau den heutigen Zulauf zu rechten und rechtspopulistischen Parteien? Sie zeigen sich mehr als beunruhigt, als sie betonen, „dass das alles damals schon einmal so angefangen hat“. Für sie sei es daher mehr denn je wichtig, populistischer Politik etwas entgegenzuhalten und sich der historischen Parallelen bewusst zu werden – eine Prämisse, die wir auch als Mahnung und Appell verstehen.
Als wir das Ehepaar einige Stunden später verlassen, liegt nach wie vor eine schwüle Sommerhitze über der Stadt, die immer noch von grauen Wolken bedeckt wird. Als wir uns auf unseren Rückweg nach Essen machen, lassen wir nicht nur einen mehrstündigen Besuch hinter uns, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit. Das vergangene Gespräch hallt in uns nach, stimmt uns nachdenklich, gibt uns aber auch Mut, und hat uns durch die Offenheit von Karl und Heiderose tief ins Gestern geführt.
Bildquelle: pexels.com